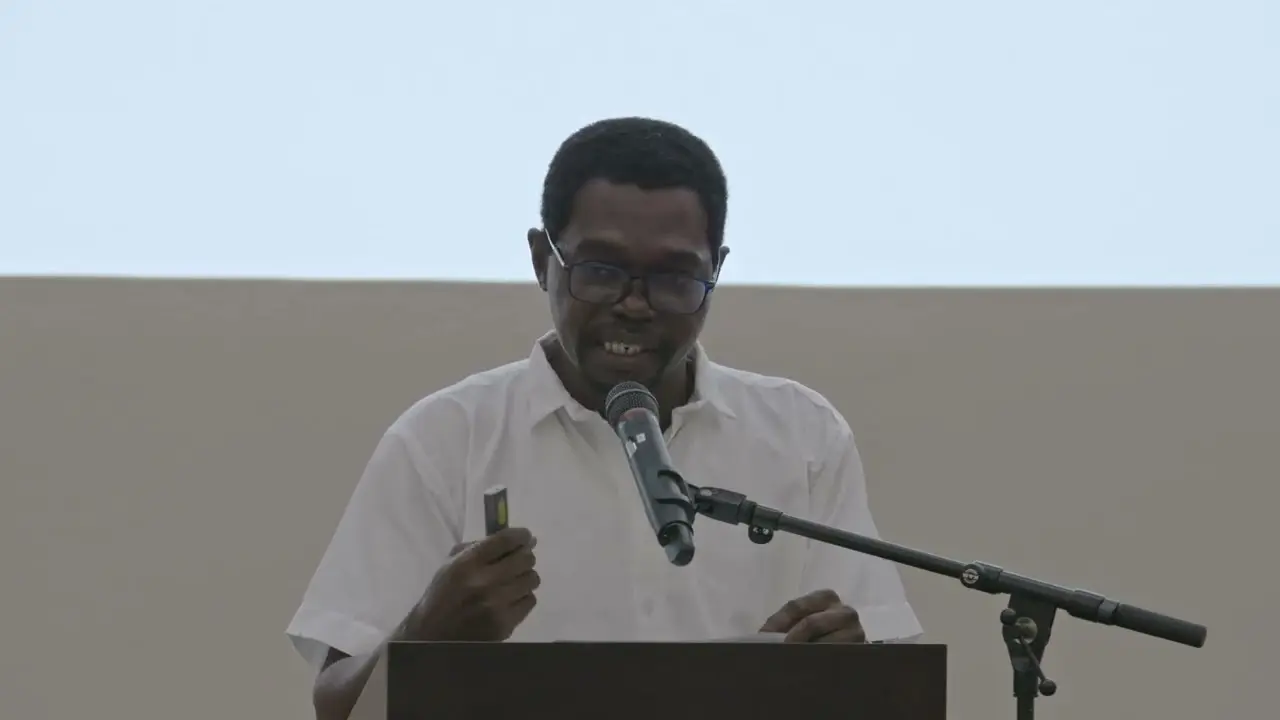Welche Verantwortung tragen wir? Reden über den deutschen Kolonialismus und seine Folgen
In Deutschland ist das Wissen über die eigene koloniale Vergangenheit und ihre Auswirkungen mitunter begrenzt. Im Unterschied zu anderen europäischen Kolonialmächten wie etwa Frankreich oder Großbritannien war die Zeitspanne des deutschen Kolonialismus zwar von kurzer Dauer (1882-1918); die Verbrechen, die in dieser Zeit begangen wurden, haben aufgrund ihrer Intensität jedoch tiefe Spuren hinterlassen.
Die öffentliche Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Geschichte intensiviert sich seit einigen Jahren in der Bundesrepublik. Diese Aushandlungen werden auch in Museen geführt und eröffnen eine erweiterte Perspektive auf die jeweiligen Sammlungen vor dem Hintergrund ihrer kolonialen Verflechtungen. Heute ist es die Aufgabe der Museen eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit zu ermöglichen. Zur Überwindung kolonialer Kontinuitäten erscheint es wichtig, die Verbrechen der Vergangenheit anzuerkennen, in den Austausch zu treten und eurozentrische Perspektiven zu hinterfragen.
Die Veranstaltungsreihe Welche Verantwortung tragen wir? Reden über den deutschen Kolonialismus und seine Folgen beschäftigt sich deshalb mit den Spuren des Kolonialismus in Museen. Konzipiert wird die Reihe von Prof. Dr. Didier Houénoudé, Professor für Kunstgeschichte an der Université d’Abomey-Calavi in Cotonou, Benin. Prof. Dr. Houénoudé und die geladenen Gäste werden den Fragen nachgehen, unter welchen Bedingungen ethnologische Sammlungen zustande gekommen sind, welche Ziele die diese verfolgten und wie die Zuschreibungen von damals die heutige Lebenswirklichkeit von Menschen in den ehemals kolonisierten Regionen und Europa bis heute prägen.
WELCHE VERANTOWRTUNG TRAGEN WIR? Reden über den deutschen Kolonialismus und seine Folgen ist eine Veranstaltungsreihe in Form von Lesungen, Podiumsdiskussionen und künstlerischen Aktivitäten, die uns wieder in den Mittelpunkt der Debatte über Themen bringen sollen, von denen wir manchmal fälschlicherweise glauben, dass sie uns nicht betreffen. Das Rahmenprogramm versteht sich als ein Forum, das Informationen über das koloniale Erbe bereitstellt und einen Austauschraum eröffnet.
Programm
vergangene Veranstaltungen
4.12.2024 | Zurückgeben, was uns nicht gehört: Wie funktioniert eigentlich Restitution? Eine Annäherung
4.12.2024 | Zurückgeben, was uns nicht gehört: Wie funktioniert eigentlich Restitution? Eine Annäherung
Die programmatische Rede des französischen Präsident Emmanuel Macron, die er am 28. November 2017 an der Universität von Ouagadougou in Burkina Faso vor 800 Studierenden hielt, öffnete die Tür für die Rückgabe von afrikanischem Kulturerbe. Einem Kulturerbe, das während der Kolonialzeit von europäischen Nationen geraubt wurde und nun an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurück gelangen sollte. Nach Frankreich, das 26 Kulturgüter an die Republik Benin und einen Säbel an den Senegal restituierte, gab Deutschland im Dezember 2022 22 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin, die während der Kolonialzeit von den Briten geraubt wurden, bedingungslos an das Herkunftsland Nigeria zurück. Die nigerianische Regierung, überträgt das Eigentum wiederum an den Oba von Benin, dem Nachkommen der beraubten Könige Benins. Das Vorgehen der nigerianischen Regierung verursachte einen Skandal in Deutschland, insbesondere in Sachsen, wo man sich um das Schicksal der Bronzen sorgte.
Das Thema wirft viele Fragen auf: Warum werden Objekte zurückgegeben? Was ist gemeint, wenn von Rückgabe die Rede ist? Welche unterschiedlichen Ansätze des Restituierens werden praktiziert?
Christine Gerbich (SKD, Outreach und Gesellschaft) diskutiert diese Fragen mit: Marion Ackermann (Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden), Didier Houénoudé (Professor für Kunstgeschichte), Birgit Scheps (SKD, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig) und Dr. Richard Tsogang Fossi (Technische Universität Berlin).
Film 4.12.
Wenn Sie unsere YouTube- oder Vimeo-Videos abspielen, werden Informationen über Ihre Nutzung von YouTube bzw. Vimeo an den Betreiber in den USA übertragen und unter Umständen gespeichert. Zudem werden externe Medien wie Videos oder Schriften geladen und in Ihrem Browser gespeichert.

28.11.2024 | Forschung über Objekte aus kolonialen Kontexten: Was hat das mit mir, dir, uns zu tun? Provenienzforschung als Lernen über die Pflege guter Beziehungen
28.11.2024 | Forschung über Objekte aus kolonialen Kontexten: Was hat das mit mir, dir, uns zu tun? Provenienzforschung als Lernen über die Pflege guter Beziehungen
Die Provenienzforschung beschäftigt sich mit der Geschichte und der Herkunft von Museumsobjekten. Im Zentrum stehen dabei Objekte, die unrechtmäßig erworben und/oder unter Einsatz von Gewalt gesammelt wurden, etwa während des Kolonialismus. Ein Anliegen der Provenienzforschung ist es, Wege für einen kritischen, ethischen, nachhaltigen und fairen Umgang mit diesen Sammlungen zu finden und dadurch Museen zu dekolonisieren. Diese Veranstaltung beschäftigt sich mit dem Nutzen der Provenienzforschung für die Verwirklichung einer gerechteren Welt. Welchen Beitrag leistet Provenienzforschung zu einer demokratischen Gesellschaft? Was können wir alle von der Provenienzforschung über die Pflege guter Beziehungen lernen? Und was lernt die Provenienzforschung durch die Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen?
Didier Houénoudé diskutiert mit Yann LeGall (Technische Universität Berlin), Tahir Della (Initiative Schwarzer Deutscher und Dekoloniale Berlin) sowie Marlena Barnstorf-Brandes und Ricarda Rivoir (GRASSI Museum Leipzig, Staatliche Kunstsammlungen Dresden).
Film 28.11.
Wenn Sie unsere YouTube- oder Vimeo-Videos abspielen, werden Informationen über Ihre Nutzung von YouTube bzw. Vimeo an den Betreiber in den USA übertragen und unter Umständen gespeichert. Zudem werden externe Medien wie Videos oder Schriften geladen und in Ihrem Browser gespeichert.

15.10.2024 | Kolonialismus: Wie kann Europa Verantwortung übernehmen? Eine panafrikanische Perspektive
15.10.2024 | Kolonialismus: Wie kann Europa Verantwortung übernehmen? Eine panafrikanische Perspektive
Die schmerzhafte Geschichte des deutschen Kolonialismus ist in Ostafrika durch das tragische Schicksal der Bevölkerung im Maji-Maji-Krieg und in Südwestafrika durch die Beinahe-Ausrottung der Herero und Nama vielen bekannt. Über die Geschichte der deutschen Präsenz in Zentralafrika, Kamerun, und Westafrika, Togo, wird dagegen weniger in der europäischen Öffentlichkeit gesprochen. Wie eignen sich die Menschen in diesen Ländern ihre Kolonialgeschichte, insbesondere die der deutschen Kolonialisierung, an? Welche Erinnerung bleibt an diese Zeit in den Erinnerungen und im Raum (hier verstanden als physischer Raum, aber auch als politischer, kultureller, religiöser oder erzieherischer Raum usw.) in diesen Ländern?
Die Veranstaltung ermöglicht Sichtweisen auf den deutschen Kolonialismus aus afrikanischer Sicht. Nach einem Grußwort von Prof. Dr. Marion Ackermann diskutiert Prof. Dr. Didier Houénoudé mit: Dr. Sonia Lawson, Direktorin des Palais de Lomé, des ehemaligen deutschen Gouverneurspalastes, der heute als Kunstzentrum dient, Dr. Hugues Heumen, Direktor des Nationalmuseums von Kamerun, und Dr. Franck Ogou, Direktor der École du Patrimoine Africain (EPA), einer panafrikanischen Schule, die sich zum Ziel gesetzt hat, das materielle und immaterielle afrikanische Erbe wieder anzueignen.
Die Diskussion findet auf Französisch statt. Eine Verdolmetschung wird mit freundlicher Unterstützung des Centrum Frankreich | Frankophonie der Technischen Universität Dresden zur Verfügung gestellt.
15.10.2024
Wenn Sie unsere YouTube- oder Vimeo-Videos abspielen, werden Informationen über Ihre Nutzung von YouTube bzw. Vimeo an den Betreiber in den USA übertragen und unter Umständen gespeichert. Zudem werden externe Medien wie Videos oder Schriften geladen und in Ihrem Browser gespeichert.

3.9.2024 | Anamnese, Schuld oder Reue? Einführung in die deutsche Kolonialgeschichte mit Prof. Dr. Didier Houénoudé
3.9.2024 | Anamnese, Schuld oder Reue? Einführung in die deutsche Kolonialgeschichte mit Prof. Dr. Didier Houénoudé
Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg im Jahr 1918 musste Deutschland nach knapp zwei Jahrzehnten Kolonialherrschaft seine Kolonien aufgeben. Während die Spuren dieser deutschen Vergangenheit in der deutschen Öffentlichkeit kaum verhandelt werden, sind sie in den Erinnerungen der kolonisierten Bevölkerung auch nach über 130 Jahren immer noch lebendig. Der Vortrag „Anamnese, Schuld oder Reue? Eine Einführung in die deutsche Kolonialgeschichte“ gibt einen ersten Einblick in die kontroverse Geschichte des deutschen Kolonialismus in Südwestafrika (Namibia), im Osten Afrika (Tansania), in Zentralafrika (Kamerun) sowie in Westafrika (Togo) und analysiert die koloniale Eroberung in Hinblick auf die heutigen Hinterlassenschaften der deutsch-afrikanischen Beziehungen. Der Vortrag versucht auch, die Grundlagen für eine neue Ethik in den Beziehungen zwischen Deutschland und den ehemaligen kolonisierten Ländern zu beleuchten.
Es sprechen: Prof. Dr. Didier Houénoudé, Professor für Kunstgeschichte an der Université d’Abomey-Calavi in Cotonou, Benin, Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und Hilke Wagner, Direktorin Albertinum
Didier Houénoudé ist Professor für Kunstgeschichte an der Université d’Abomey-Calavi in Cotonou, Benin. Bekannt ist er vor allem für seine Forschung zu zeitgenössischer Kunst und den historischen Kulturgütern in Benin sowie für sein kulturpolitisches Engagement zu kolonialem Kunstraub und der Restitution von Kulturgut.
3.9.24
Wenn Sie unsere YouTube- oder Vimeo-Videos abspielen, werden Informationen über Ihre Nutzung von YouTube bzw. Vimeo an den Betreiber in den USA übertragen und unter Umständen gespeichert. Zudem werden externe Medien wie Videos oder Schriften geladen und in Ihrem Browser gespeichert.